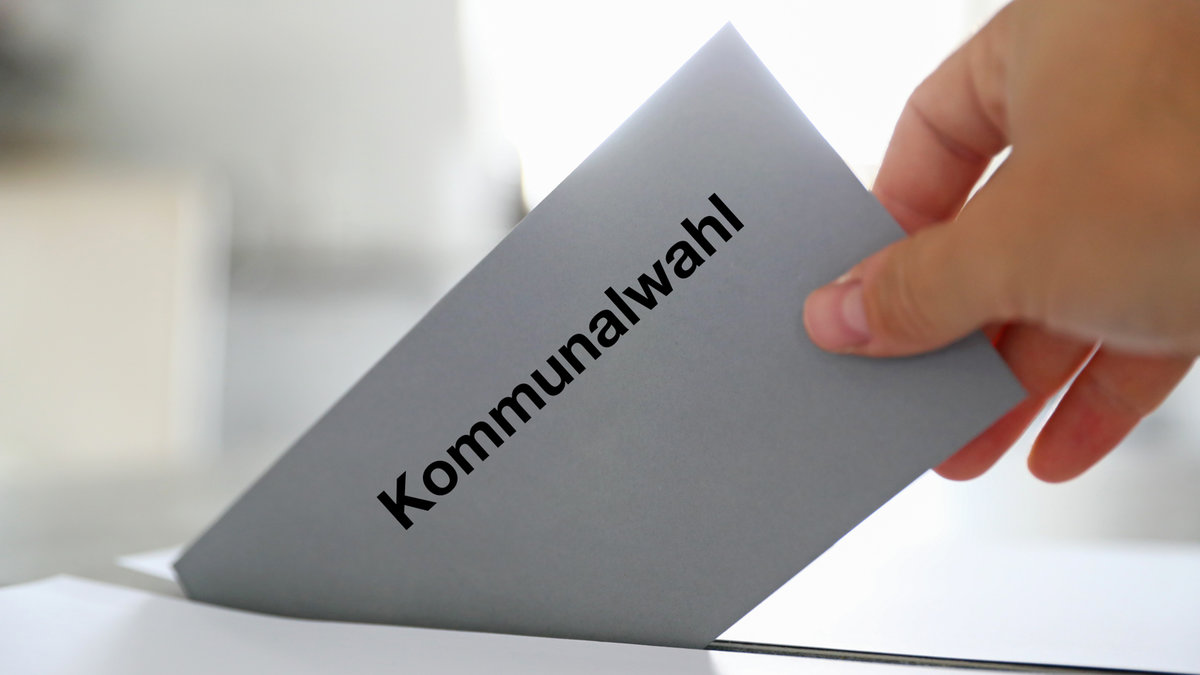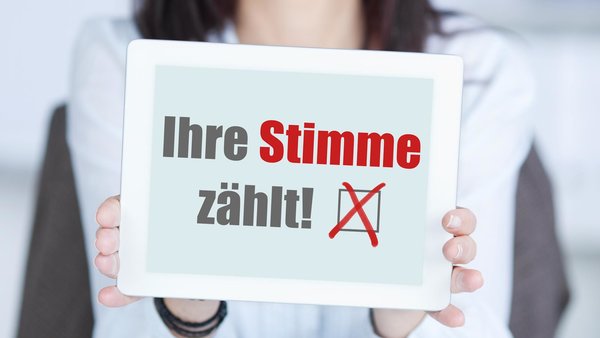Die Liste der Aufgaben, die Städte erfüllen müssen, ist lang! Unter anderem sind sie für Folgendes zuständig:
- Wasser- und Energieversorgung
- Abwasser- und Müllbeseitigung sowie Straßenreinigung
- Bauplanung und -aufsicht
- Unterhalt von Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten und Friedhöfen
- Mobilität inklusive ÖPNV
- Straßenbau, -unterhalt und -ausbau
- örtliche Feuerwehr und Ordnungsamt
- städtischer Klima- und Umweltschutz sowie Wärmeplanung
- Digitale Infrastruktur wie z.B. der Breitband- und Glasfaserausbau
Zu den freiwilligen Aufgaben gehören zudem Sport, Kultur, Vereine und Ehrenamt, Soziales (wie Jugend-, Senioren- oder Integrationsarbeit) sowie Freizeit- und Erholungsangebote. Städte gestalten also das Lebensumfeld der Meschen aktiv und unmittelbar. Das gilt insbesondere auch für das Thema Wohnen und ist deshalb für Eigentümerinnen und Eigentümer bei der Kommunalwahl besonders wichtig?
 © Verband Wohneigentum NRW/Gemeinschaft Rheda-Wiedenbrück
© Verband Wohneigentum NRW/Gemeinschaft Rheda-Wiedenbrück