Im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung müssen Sie als Kamerabetreiber nachweisen, dass die Videoüberwachung zulässig ist. So können Sie sich absichern:
- Dokumentieren Sie den Anlass für die Videoüberwachung. Das können z. B. eine Einbruchserie in der Nachbarschaft oder wiederholt auftauchende Graffitis an Ihrer Garagenwand sein.
- Installieren Sie eine nicht schwenkbare Kamera ohne Abdeckung, sodass die Ausrichtung von außen erkennbar ist.
- Verzichten Sie auf digitale Sonderfunktionen, etwa Gesichtserkennung, automatische Bewegungsverfolgung oder Audioaufnahme, und bewahren Sie die Produktinformationen auf.
- Sorgen Sie dafür, dass nicht benötigte Aufnahmen nach spätestens 72 Stunden gelöscht werden.
- Achten Sie bei Cloud-Speicherung auf eine verschlüsselte Übertragung und einen Server-Standort in einem EU-Land.
- Hängen Sie an sichtbarer Stelle ein Warnschild gemäß den Vorgaben der DSGVO auf.
Vorsicht: Viele Anbieter von Überwachungskameras werben mit modernsten Zusatzfunktionen, etwa KI-gestützten Erkennungsfunktionen, langer Speicherdauer oder Auto-Tracking – doch genau das sind die Punkte, die eine private Videoüberwachung in Deutschland illegal machen. Um eine Kamera rechtskonform zu betreiben, sollten Sie Überwachung und Funktionen auf das Minimum beschränken.
Übrigens: Wie Sie Einbrecher auf andere Weise von Ihrem Wohneigentum fernhalten, erfahren Sie in unserem Artikel zum Einbruchschutz. Darüber hinaus veranstaltet der Verband Wohneigentum NRW regelmäßig Webinare rund um den Einbruchschutz.
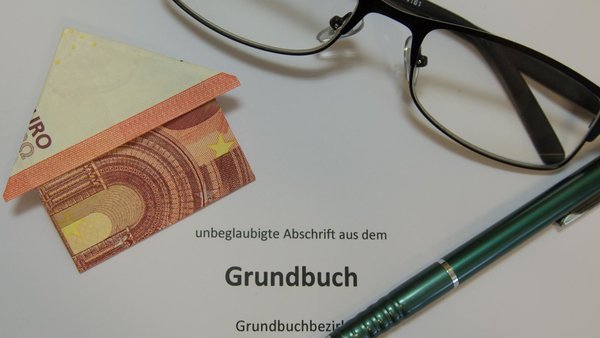 © Verband Wohneigentum NRW e.V.
© Verband Wohneigentum NRW e.V.




