Mit der Eigentümerversammlung können Eigentümer Beschlüsse fassen und alle Aspekte zur Verwaltung des gemeinsamen Eigentums klären. Sie muss mindestens einmal pro Jahr in Präsenz oder virtuell stattfinden. Wie eine Eigentümerversammlung abläuft, kann die Eigentümergemeinschaft selbst festlegen. In der Regel gibt es eine Tagesordnung, die der Verwalter festlegt. Zum Inhalt gehören beispielsweise:
- Jahresabrechnung
- Wirtschaftsplan: enthält geplante Ausgaben und Einnahmen
- Höhe künftiger Rücklagen, ggf. Sonderumlagen
- Verwalterwechsel
- ggf. Änderung der Hausordnung
- geplante Baumaßnahmen, Renovierungen usw.
- weitere Entscheidungen zum Gemeinschaftseigentum, z. B. Anschaffung einer PV-Anlage, Wechsel des Hausmeisters
Neben der jährlichen Pflichtversammlung können außerordentliche Eigentümerversammlungen stattfinden. Diese kann sowohl der Verwalter bzw. Vorsitzende als auch ein Teil der Eigentümergemeinschaft (mindestens 25 Prozent) einberufen.
Interessant: Eine Anwesenheitspflicht für die Versammlungen besteht nicht. Wohnungsbesitzer haben jedoch oft ein eigenes Interesse an der Teilnahme – denn nach dem WEG ist die Eigentümerversammlung grundsätzlich beschlussfähig, unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder.
Teilnahmeberechtigt sind übrigens nur Eigentümer bzw. von ihnen autorisierte Vertreter. Insofern dürfte auch ein Mieter an der Eigentümerversammlung teilnehmen, wenn ihn der Eigentümer offiziell als Vertreter benennt. Der Mieter darf – mit entsprechender Vollmacht – auch im Namen des Eigentümers abstimmen.
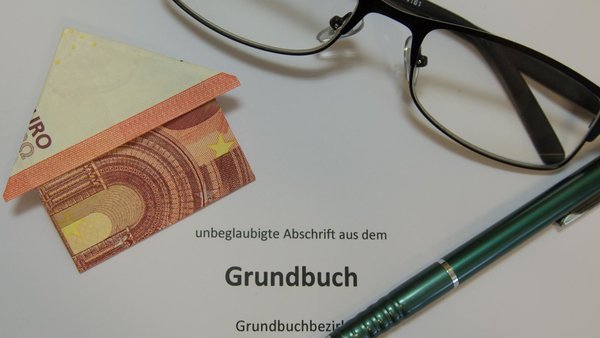 © Verband Wohneigentum NRW e.V.
© Verband Wohneigentum NRW e.V.



